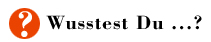Eine Methode der Bibelwissenschaft, die Anfang des 20. Jahrhunderts durch Hermann Gunkel (1862-1932) und Hugo Greßmann (1877-1927) für das AT und wenig später durch Rudolf Bultmann (1884-1976), Martin Dibelius (1883-1947) und Karl-Ludwig Schmidt (1891-1956) für das NT eingeführt wurde. Als Methode fragt die Formgeschichte nach den mündlichen Überlieferungen, die hinter einem schriftlichen Bibeltext liegen, genauer ..
Tag : Bibel
Fachausdruck der Formgeschichte zur Bezeichnung der sozialen und kulturellen Bedingungen und Gegebenheiten, denen eine Form oder eine Gattung ihre Entstehung verdankt und innerhalb derer sie ihre Funktion hat. Man sagt heute auch entsprechend: Funktion von Texten in Situationen des Zusammenlebens. So ist z.B. der »Sitz im Leben« eines Leichenlieds das Begräbnisritual, der vieler Psalmen der ..
Eine sichtbare oder auch als Statue greifbare Darstellung Gottes. Da Gott unsichtbarer Geist ist, kann man nur eine menschliche Vorstellung von Gott abbilden, aber mit dem Zweck, diesen Gott »näher« zu haben, um ihn »ansprechen« zu können. Dieses Bedürfnis hatten die Menschen des Heidentums zu allen Zeiten. Bestrebungen gab und gibt es auch bei den ..
Blut des Menschen (und des Tieres) ist der Grund, Sitz, Voraussetzung des Lebens und sozusagen gleichbedeutend mit Leben. Von daher ist auch das im NT so oft angesprochene Blut Christi zu sehen und zu deuten. Es geht also nicht um das »Blutige« des Todes Jesu, bei dem dieses Blut bis zum letzten Tropfen geflossen ist. ..
Bibelwissenschaft ist der theologische Bereich, der sich zunächst um intensives Verständnis und textgemäße Erklärung der ganzen Heiligen Schrift (bei uns in den deutschen Ländern getrennt in NT und AT) bemüht, dann aber auch mittelbar und unmittelbar der Verkündigung und dem christlichen Leben (aus dem Geist der Bibel) dient. Inhaltlich und methodisch gehört sie zu den ..
Diese meint (im Unterschied zur siehe Auferstehung) eine Rückkehr ins irdische, vorläufige Leben. Die Auferstehung (bzw. eschatologische Erweckung) bedeutet hingegen einen totalen Neuanfang, Sieg über den Tod und eine neue endgültige Ordnung der Dinge (siehe Mt 22,30). Von Wiederbelebungen des Körpers liest man bereits im AT (1.Kön 17,22: Elija erweckt einen Knaben; 2.Kön 4,31-37: Elischa ..
In der Umwelt Israels (von Ägypten bis Mesopotamien) wurde die Totenbeschwörung gepflegt. Der Versuch, über die Toten etwas über das kommende Schicksal der Lebenden zu erfahren, führte in Babylon dazu, dass eine eigene Klasse von Priestern für diese Aufgabe zuständig war. In Israel gab es zwei gegensätzliche Erscheinungen: einerseits wucherte in den völkisch stark vertretenen ..
Für den Orientalen und somit auch für den Menschen des AT bedeutet Tod nicht (medizinisch) den Moment des Sterbens (Exitus), auch nicht (wie in der griechischen Philosophie) die Trennung der Seele vom Leib, sondern den Verlust der Lebenskraft, Vitalität und der Fähigkeit zur Bewegung, den Verlust des Lebensstoffes, des Lebenshauchs, den Gott dem Menschen für ..
Die Szene, die in Mk 9,2-10, Mt 17,1-9 und Lk 9,28-36 geschildert wird, nennt man »Verklärung Jesu«. Vor den Augen seiner Jünger wird Jesus auf einem Berg (siehe Tabor) in göttliche Gestalt verwandelt. Das Ereignis wird von Vorgängen begleitet, wie sie von den Gotteserscheinungen in der Wüste am Sinai bekannt sind: Wolke und Stimme (Ex ..
Der Berg der Verklärung Jesu ist wohl der Berg Tabor, ein 588 Meter hoher einzelstehender Bergkegel in der Ebene Jesreel, etwa 8 km östlich von Nazaret. In Dtn 33,19 wird der imponierende Berg (Ps 89,13; Jer 46,18) ohne Namensnennung als Kultstätte der Lea- Stämme Sebulon und Issachar erwähnt. Wahrscheinlich ist, dass auf dem Tabor Israel ..